Martin Breindl/Bernhard Kathan,
ZUFÄLLE EINFÄLLE FÜGUNGEN
ZUFÄLLE EINFÄLLE FÜGUNGEN
in situ performance/installation, 2023
buffet, sawdust, 3 robot hoovers, 3 bluetooth loudspeakers
buffet, sawdust, 3 robot hoovers, 3 bluetooth loudspeakers
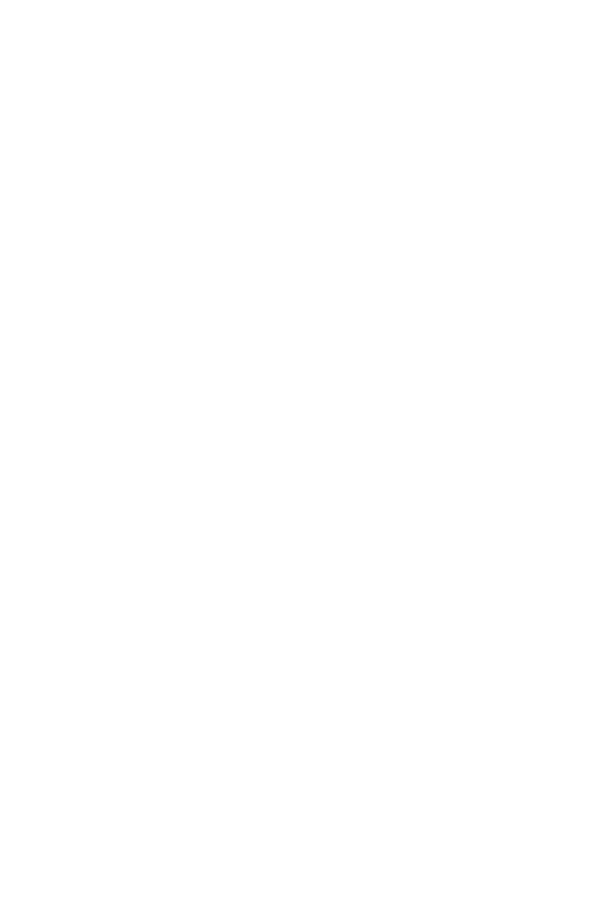
ZUFÄLLE EINFÄLLE FÜGUNGEN, sketch by Martin Breindl
A lavish buffet. On the floor, lettering set with the help of stencils and sawdust can be seen that thematically refer to economic interactions. Robot vacuum cleaners, carrying loudspeakers. When the visitors have gathered shortly before nightfall, the vacuum cleaners are put into operation and the radio drama "The Inn at the Hand of the Hanged Man" starts to sound. At this very moment you are asked to enter the area delimited with squared timbers (a boundary must be set for the robots) and help yourself to the buffet. You are invited to move freely and converse. Under no circumstances should your attention be focused on the audio piece, as strained listening has never resulted in increased attention. The volume of the speakers takes into account your need for conversation. You experience a constantly changing sound impression, while the robot vacuum cleaners randomly suck away the writing on the floor here and there. You may be anxious not to step on the lettering at first, but sooner or later it blurs under your shoes. After 54 minutes, we are dealing with a completely different picture than at the beginning.
radio drama: text Bernhard Kathan, music Manuela Kerer, director Martin Sailer, voice Sophie Wendt
thanks to: „Stiftung für fliessenden Kunstverkehr“, Ruth Kathan, Ksenia Yurkova
radio drama: text Bernhard Kathan, music Manuela Kerer, director Martin Sailer, voice Sophie Wendt
thanks to: „Stiftung für fliessenden Kunstverkehr“, Ruth Kathan, Ksenia Yurkova
Video, 07:07, by Ksenia Yurkova
PERFORMANCE
___ ruwa holzbau ag, Küblis, CH, 20.5.2023, 8pm
Bernhard Kathan, ZUFÄLLE. EINFÄLLE. FÜGUNGEN [German only]
Kaufte mir ein Paar Schuhe. Sie kosteten mich gerade einmal 30 Euro, also einen Betrag, um den man sich heute nicht mehr viel kaufen kann. In einer naturalwirtschaftlich organisierten Gesellschaft hätten vergleichbare Schuhe ein Vielfaches gekostet. Aber da waren Tauschgeschäfte noch eine komplizierte Angelegenheit: Wie lange muss man Fronarbeit leisten für ein Paar Schuhe? Wie ist ein Kalb mit Holz zu verrechnen? Käse mit Most? Wie ist eine Totenwache abzugelten? Ein Botengang? Ein Krankenbesuch? Mochte es auch allgemein anerkannte Richtwerte geben, so war doch auch Sachfremdes wie Verwandtschaft, frühere aus ganz anderen Gründen erbrachte und nun reklamierte Gegenleistungen, der gesellschaftliche Status wie vieles andere von Bedeutung. Die Geldwirtschaft hat uns davon befreit. Nicht länger müssen wir Schuhe bei einem Schuhmacher kaufen, nur weil er mit uns verwandt ist.
Die Geldwirtschaft, so Georg Simmel 1896, „schiebt zwischen die Person und die bestimmt qualifizierte Sache in jedem Augenblick die völlig objektive, an sich qualitätlose Instanz des Geldes und Geldwertes. Sie stiftet eine Entfernung zwischen Person und Besitz, indem sie das Verhältnis zwischen beiden zu einem vermittelten macht. Sie hat damit das frühere enge Zusammengehören des personalen und des lokalen Elementes bis zu dem Grade differenziert, dass ich heute in Berlin meine Einkünfte aus amerikanischen Eisenbahnen, norwegischen Hypotheken und afrikanischen Goldminen empfangen kann.“
Ohne jeden Zweifel verdankt sich unser Wohlstand neben der Industrialisierung vor allem der „qualitätslosen Instanz des Geldes und des Geldwertes“, wurden wir doch so von allen hemmenden Verpflichtungen naturalwirtschaftlicher Gesellschaften befreit. Die Geldwirtschaft entmischt, und das auf allen Ebenen, auch auf jenen der Produktion wie des Konsums. Dass sich die erwähnten Schuhe oft genug Kindern oder Frauen in Bangladesch verdanken, die maschinengleich stets dieselben Handgriffe ausführen, das teilen sie nicht mit.
Das Sprichwort „Geld stinkt nicht“ meint genau das: So abgegriffen Geldscheine auch sein mögen, sie repräsentieren immer nur ihren Wert im Geldgefüge. Geld ist charakterlos und diskret. Im Gegensatz zu Naturalleistungen verweist Geld, sieht man vom Akt der Bezahlung ab, weder auf denjenigen, der bezahlt, noch auf diejenigen, die eine Ware hergestellt oder eine Dienstleistung erbracht haben. Und dann wird Geld doch, wenn auch nur vage, als geschichtlich wahrgenommen, als etwas, was durch viele Hände gegangen und somit „schmutzig“ ist. Erst im elektronischer Zahlungsverkehr ist Geld endgültig von allen Spuren gereinigt, ist es doch durch keine Hände mehr gegangen.
Inzwischen werden wir uns wieder bewusst, dass Geld doch stinken kann, zumindest, dass ein Kaufakt oder eine Transaktion, die vorgibt, uns zu entschulden, doch diese oder jene Folgen an ganz anderen Orten haben kann. Spätestens seit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine lässt sich nicht mehr leugnen, dass die Welt ein System kommunizierender Gefäße ist.
Da es um Holz, um Fichten und Tannen geht, drängt sich Wilhelm Hauffs „Das Wirtshaus im Spessart“ auf. Da finden sich ökonomische Fragen mehrfach durchgespielt, auf der einen Seite der verpflichtende Tausch, auf der anderen die bindungslose Ökonomie, nicht zufällig, erschien doch der dritte Märchen-Almanach im Jahr 1828, also wenige Jahre nach der durch Massenprodukte der englischen Industrie ausgelösten Wirtschaftskrise. Auch vor dem Schwarzwald hat die Geldwirtschaft nicht Halt gemacht, hatte sich doch auch hier längst herumgesprochen, dass die „stärksten und längsten Balken“ den grüßten Gewinn dann abwerfen, werden sie in Holland an Schiffsbauer verkauft. Aber: „Fällt der Holländer-Michel in einer Sturmnacht eine Tanne im Schwarzwald, springt eine seiner alten aus den Fugen des Schiffes, das Wasser dringt ein, und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren.“ Das Märchen-Motiv hatte also einen durchaus wahren Kern. Ereignisse an weit entfernten Orten, technologische Neuerungen, Kriege, die ganz woanders stattfinden, können verheerende Folgen für das unmittelbare, vermeintlich stabile Wirtschaftsleben haben.
In der Rahmenhandlung tauscht der junge Goldschmied Felix in einem Wirtshaus seine Kleider mit einer Gräfin, um ihr die Schande zu ersparen, von Räubern gefangen zu werden. Dass die Gräfin seine Patin ist, zu der er sich auf den Weg gemacht, um ihr den Schmuck bringen, den sie sich von ihm anfertigen ließ, um sich von seinem Können zu überzeugen, das weiß Felix nicht. Ausgerechnet ihr vertraut er seinen Schmuck an. Er würde sich lieber in kleine Stücke schneiden lassen, als ihn den Räubern überlassen, hat doch seine Patin Lehre, Kleidung und Essen bezahlt. Am Ende, als sich Patenkind und Patin erkennen, schlägt Felix alle Belohnung aus und überlässt der Gräfin seine Kleidung.
Hauff strickt die in der Rahmenhandlung behandelte Frage von Aneignung und Tausch in den eingeschobenen Märchen fort, insbesondere im Märchen „Das kalte Herz“, in dem der Köhlerssohn Peter Munk sein Herz gegen eines aus Stein (und Reichtum) tauscht. Felix und Peter Munk kennen zahllose Entsprechungen. Beide geben etwas preis. Peter sein Herz, Felix das Geschmeide. Da wie dort haben wir es mit Steinen zu tun, mit einem Herz aus Stein, mit gefassten Steinen. Vertraut Felix seinen Schmuck der Gräfin an, so gibt er sich preis. Gibt Peter sein Herz als Pfand, dann begibt sich in eine Schuld, die sich nicht abtragen lässt. Er verkauft sich selbst. Mag Peter noch so viel Geld haben, so bleibt er doch beziehungslos. Andere bilden bestenfalls Krücken für sein Ich. Felix hängt an einzelnen Dingen nicht ihres Wertes, sondern ihrer Bedeutung wegen. Er wünscht sich nicht in Frauenkleider, und seien diese aus noch so feiner Seide gearbeitet. Er gibt die seinen hin, weil Umstände es erfordern. Peter tauscht seine Kleider nicht. Er findet sich in neuen Kleidern vor, als er in der Postkutsche aufwacht.
In Hauffs ökonomischen Vorstellungen wird der glücklich, der verpflichtende Bindungen anerkennt. Und so kann das Märchen denn auch nur in einem Bauernhaus enden, in dem alles „gut und reinlich“ ist, in einem von Natur umgebenen Haus. Will man dem Märchen glauben, so soll Peter Munk schließlich fleißig als Köhler gearbeitet haben und ohne viel Geld zu einem anerkannten Mann geworden sein, obwohl sein Handwerk angesichts der vielen Kohlegruben, Dampfmaschinen und Transportmöglichkeiten längst keine wirkliche Zukunft mehr hatte. Deshalb bedurfte es einer Kulissenwelt, in der „die Wege noch schlecht und nicht so häufig als jetzt befahren waren.“
Dabei sind bereits im ersten Satz mobile Menschen angesprochen. Das Märchen beginnt nicht mit der zumeist üblichen Formel: „Es war einmal …“. Vielmehr lautet der erste Satz ganz der damaligen Reiseliteratur entsprechend: „Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen; nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermeßliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute.“
Nicht zufällig lässt Hauff Peter Munk eine Weltreise unternehmen: „Er fuhr zwei Jahre in der Welt umher und schaute aus seinem Wagen links und rechts an den Häusern hinauf, schaute, wenn er anhielt, nichts als das Schild seines Wirtshauses an, lief dann in der Stadt umher und ließ sich die schönsten Merkwürdigkeiten zeigen. Aber es freute ihn nichts, kein Bild, kein Haus, keine Musik, kein Tanz; sein Herz von Stein nahm an nichts Anteil, und seine Augen, seine Ohren waren abgestumpft für alles Schöne. Nichts war ihm mehr geblieben als die Freude an Essen und Trinken und der Schlaf, und so lebte er, indem er ohne Zweck durch die Welt reiste, zu seiner Unterhaltung speiste und aus Langeweile schlief.“ Richard Sennett zufolge hat diese Weltreise eine Art taktiler Krise zur Folge: „Willst du dich frei bewegen, dann darfst du nicht allzu viel fühlen.“
In dieselbe Zeit fällt das Grimm‘sche Märchen „Die drei Feldscherer“. Auch hier haben wir es mit mobilen Menschen zu tun, mit Menschen, die keine Bindung kennen, finden doch Kriege, in denen Feldscher ihr Können unter Beweis stellen, einmal da, dann dort statt. Auch hier spielt die Geschichte in einem Gasthaus, also an einem Nicht-Ort, an dem die Gesetze des Geldverkehrs gelten, an einem Ort, dessen soziales Leben sich allgemeiner Codes verdankt. An all solchen Orten sind die Zahlungsmodalitäten mehr oder weniger dieselben. Aber da sich, würde alles so funktionieren wie vorgegeben, keine Geschichte, schon gar kein Märchen erzählen ließe, muss einiges durcheinander geraten, bedarf es eines unvorhergesehenen Zufalls.
Die drei Feldscherer sind im Besitz einer Salbe, die jede Wunde zu heilen vermag. Um dem Wirt ihre Kunst zu beweisen, schneidet sich der erste seine Hand ab, der zweite reißt sich sein Herz heraus, der dritte sticht sich seine Augen aus, um sie am folgenden Morgen wieder einzuheilen. Sie überlassen ihre Organe dem Wirt, der sie auf einen Teller legt und das Mädchen heißt, diesen in den Schrank zu stellen und wohl aufheben. Das Mädchen hat „einen heimlichen Schatz“, einen Soldaten, der ebenso bindungslos ist wie die drei Feldscherer. Als alle im Haus schlafen, kommt der Soldat und will etwas zu essen haben. Das Mädchen geht zum Schrank, holt Brot, Wurst und Käse, vergisst aber, den Kasten wieder zu verschließen. Kurz und gut: Eine Katze frisst die auf den Teller gelegten Organe. Der Soldat weiß Abhilfe, als sich das Mädchen dessen bewusst wird. Die Hand beschafft er sich von einem Dieb, den man gehängt hat, die Augen sticht er einer Katze aus, auch für das Herz findet sich Ersatz, liegt doch im Keller ein frisch geschlachtetes Schwein. Am folgenden Morgen heilen sich die drei Feldscherer die ihnen untergeschobenen Organe ein und werden vom Wirt bewundert. Nur schnüffelt der eine schon bald wie ein Schwein in jeder Ecke, der mit der Diebeshand beginnt zu stehlen und der mit den Katzenaugen sieht plötzlich Mäuse, wo die anderen keine sehen.
Nicht zufällig haben wir es auch im Hauff‘schen Märchen mit einem Organtausch zu tun. Peter Munk wird anstelle seines eigenen Herzens eines aus Stein eingesetzt. Zweifellos hatte Hauff anatomische Präparate vor Augen: „Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser, mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt, und in jedem dieser Gläser lag ein Herz; auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben.“ Gleichzeitig klingt das Sortiment eines Warenhauses an. Dabei ist das Motiv dem Buch Ezechiel entlehnt: „Ich werde ihnen ein einziges Herz geben und einen neuen Geist in ihr Inneres legen und werde entfernen das Herz aus Stein aus ihrem Leibe und ihnen ein Herz von Fleisch geben.“
Wir können nicht zurück in das Hauff‘sche Idyll. Es gibt kein Glasmännlein, das uns vor den Versprechen eines Holländer-Michel bewahren könnte. Die Globalisierung lässt sich nicht rückgängig machen. Wohl aber müsste es möglich sein, Produkte komplexer zu denken, damit sie jenen Mehrwert erlangen, der sich als Schönheit bezeichnen ließe, Produkte, die in ihrer Funktionalität umfassender sind, als dies ein Massenprodukt je sein kann.
Ich kaufe Fleisch in einer kleinen Metzgerei, in einer der wenigen noch verbliebenen Metzgereien. Ganz abgesehen davon, dass das hier angebotene Fleisch von Bauern der Umgebung stammt oder dass man bestens auf die Zubereitung eingestimmt wird, kann man, vor einer Vitrine stehend, in der neben vielem anderen noch Schweinsfüße und Kalbszungen liegen, dem Metzger dabei zusehen wie er mit gekonnten Bewegungen das gewünschte Fleisch auswählt und kunstfertig herrichtet. Kaufen wir vakuumiertes Fleisch in einem Supermarkt, dann bietet sich dieses nach dem Öffnen als bluttriefender Klumpen dar. Hier dagegen haben wir es mit gut abgehangenem Fleisch zu tun, das seine ganze Struktur zeigt. Während dort alles stumm ist, wird hier gesprochen, kommentiert, oft auch erzählt. Auch trägt der Metzger keine Plastikhandschuhe, weiß er doch, dass solche wenig mit Hygiene, viel dagegen mit jenem Unbehagen zu tun haben, das mit heutigen Produktionsformen einhergeht. Keinesfalls haben wir es mit einem Konsumakt zu tun, in dem man als Konsument einer ähnlichen Bewirtschaftung unterliegt wie die angebotenen Waren. Man kennt sich, man unterhält sich. So eine Metzgerei ist noch ein sozialer Raum, auf jeden Fall noch eine Schnittstelle zwischen Produzenten und Konsumenten. Da klingt das an, was ich mit Schönheit meine. Gelobt seien gute technische Lösungen, aber ohne Rückbindung in das Soziale, das konkrete Leben der Menschen, kann es keine Schönheit geben. Das gilt für Nahrungsmittel wie Fleisch, für Holzbauten und vieles andere.
Kaufte mir ein Paar Schuhe. Sie kosteten mich gerade einmal 30 Euro, also einen Betrag, um den man sich heute nicht mehr viel kaufen kann. In einer naturalwirtschaftlich organisierten Gesellschaft hätten vergleichbare Schuhe ein Vielfaches gekostet. Aber da waren Tauschgeschäfte noch eine komplizierte Angelegenheit: Wie lange muss man Fronarbeit leisten für ein Paar Schuhe? Wie ist ein Kalb mit Holz zu verrechnen? Käse mit Most? Wie ist eine Totenwache abzugelten? Ein Botengang? Ein Krankenbesuch? Mochte es auch allgemein anerkannte Richtwerte geben, so war doch auch Sachfremdes wie Verwandtschaft, frühere aus ganz anderen Gründen erbrachte und nun reklamierte Gegenleistungen, der gesellschaftliche Status wie vieles andere von Bedeutung. Die Geldwirtschaft hat uns davon befreit. Nicht länger müssen wir Schuhe bei einem Schuhmacher kaufen, nur weil er mit uns verwandt ist.
Die Geldwirtschaft, so Georg Simmel 1896, „schiebt zwischen die Person und die bestimmt qualifizierte Sache in jedem Augenblick die völlig objektive, an sich qualitätlose Instanz des Geldes und Geldwertes. Sie stiftet eine Entfernung zwischen Person und Besitz, indem sie das Verhältnis zwischen beiden zu einem vermittelten macht. Sie hat damit das frühere enge Zusammengehören des personalen und des lokalen Elementes bis zu dem Grade differenziert, dass ich heute in Berlin meine Einkünfte aus amerikanischen Eisenbahnen, norwegischen Hypotheken und afrikanischen Goldminen empfangen kann.“
Ohne jeden Zweifel verdankt sich unser Wohlstand neben der Industrialisierung vor allem der „qualitätslosen Instanz des Geldes und des Geldwertes“, wurden wir doch so von allen hemmenden Verpflichtungen naturalwirtschaftlicher Gesellschaften befreit. Die Geldwirtschaft entmischt, und das auf allen Ebenen, auch auf jenen der Produktion wie des Konsums. Dass sich die erwähnten Schuhe oft genug Kindern oder Frauen in Bangladesch verdanken, die maschinengleich stets dieselben Handgriffe ausführen, das teilen sie nicht mit.
Das Sprichwort „Geld stinkt nicht“ meint genau das: So abgegriffen Geldscheine auch sein mögen, sie repräsentieren immer nur ihren Wert im Geldgefüge. Geld ist charakterlos und diskret. Im Gegensatz zu Naturalleistungen verweist Geld, sieht man vom Akt der Bezahlung ab, weder auf denjenigen, der bezahlt, noch auf diejenigen, die eine Ware hergestellt oder eine Dienstleistung erbracht haben. Und dann wird Geld doch, wenn auch nur vage, als geschichtlich wahrgenommen, als etwas, was durch viele Hände gegangen und somit „schmutzig“ ist. Erst im elektronischer Zahlungsverkehr ist Geld endgültig von allen Spuren gereinigt, ist es doch durch keine Hände mehr gegangen.
Inzwischen werden wir uns wieder bewusst, dass Geld doch stinken kann, zumindest, dass ein Kaufakt oder eine Transaktion, die vorgibt, uns zu entschulden, doch diese oder jene Folgen an ganz anderen Orten haben kann. Spätestens seit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine lässt sich nicht mehr leugnen, dass die Welt ein System kommunizierender Gefäße ist.
Da es um Holz, um Fichten und Tannen geht, drängt sich Wilhelm Hauffs „Das Wirtshaus im Spessart“ auf. Da finden sich ökonomische Fragen mehrfach durchgespielt, auf der einen Seite der verpflichtende Tausch, auf der anderen die bindungslose Ökonomie, nicht zufällig, erschien doch der dritte Märchen-Almanach im Jahr 1828, also wenige Jahre nach der durch Massenprodukte der englischen Industrie ausgelösten Wirtschaftskrise. Auch vor dem Schwarzwald hat die Geldwirtschaft nicht Halt gemacht, hatte sich doch auch hier längst herumgesprochen, dass die „stärksten und längsten Balken“ den grüßten Gewinn dann abwerfen, werden sie in Holland an Schiffsbauer verkauft. Aber: „Fällt der Holländer-Michel in einer Sturmnacht eine Tanne im Schwarzwald, springt eine seiner alten aus den Fugen des Schiffes, das Wasser dringt ein, und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren.“ Das Märchen-Motiv hatte also einen durchaus wahren Kern. Ereignisse an weit entfernten Orten, technologische Neuerungen, Kriege, die ganz woanders stattfinden, können verheerende Folgen für das unmittelbare, vermeintlich stabile Wirtschaftsleben haben.
In der Rahmenhandlung tauscht der junge Goldschmied Felix in einem Wirtshaus seine Kleider mit einer Gräfin, um ihr die Schande zu ersparen, von Räubern gefangen zu werden. Dass die Gräfin seine Patin ist, zu der er sich auf den Weg gemacht, um ihr den Schmuck bringen, den sie sich von ihm anfertigen ließ, um sich von seinem Können zu überzeugen, das weiß Felix nicht. Ausgerechnet ihr vertraut er seinen Schmuck an. Er würde sich lieber in kleine Stücke schneiden lassen, als ihn den Räubern überlassen, hat doch seine Patin Lehre, Kleidung und Essen bezahlt. Am Ende, als sich Patenkind und Patin erkennen, schlägt Felix alle Belohnung aus und überlässt der Gräfin seine Kleidung.
Hauff strickt die in der Rahmenhandlung behandelte Frage von Aneignung und Tausch in den eingeschobenen Märchen fort, insbesondere im Märchen „Das kalte Herz“, in dem der Köhlerssohn Peter Munk sein Herz gegen eines aus Stein (und Reichtum) tauscht. Felix und Peter Munk kennen zahllose Entsprechungen. Beide geben etwas preis. Peter sein Herz, Felix das Geschmeide. Da wie dort haben wir es mit Steinen zu tun, mit einem Herz aus Stein, mit gefassten Steinen. Vertraut Felix seinen Schmuck der Gräfin an, so gibt er sich preis. Gibt Peter sein Herz als Pfand, dann begibt sich in eine Schuld, die sich nicht abtragen lässt. Er verkauft sich selbst. Mag Peter noch so viel Geld haben, so bleibt er doch beziehungslos. Andere bilden bestenfalls Krücken für sein Ich. Felix hängt an einzelnen Dingen nicht ihres Wertes, sondern ihrer Bedeutung wegen. Er wünscht sich nicht in Frauenkleider, und seien diese aus noch so feiner Seide gearbeitet. Er gibt die seinen hin, weil Umstände es erfordern. Peter tauscht seine Kleider nicht. Er findet sich in neuen Kleidern vor, als er in der Postkutsche aufwacht.
In Hauffs ökonomischen Vorstellungen wird der glücklich, der verpflichtende Bindungen anerkennt. Und so kann das Märchen denn auch nur in einem Bauernhaus enden, in dem alles „gut und reinlich“ ist, in einem von Natur umgebenen Haus. Will man dem Märchen glauben, so soll Peter Munk schließlich fleißig als Köhler gearbeitet haben und ohne viel Geld zu einem anerkannten Mann geworden sein, obwohl sein Handwerk angesichts der vielen Kohlegruben, Dampfmaschinen und Transportmöglichkeiten längst keine wirkliche Zukunft mehr hatte. Deshalb bedurfte es einer Kulissenwelt, in der „die Wege noch schlecht und nicht so häufig als jetzt befahren waren.“
Dabei sind bereits im ersten Satz mobile Menschen angesprochen. Das Märchen beginnt nicht mit der zumeist üblichen Formel: „Es war einmal …“. Vielmehr lautet der erste Satz ganz der damaligen Reiseliteratur entsprechend: „Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen; nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermeßliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute.“
Nicht zufällig lässt Hauff Peter Munk eine Weltreise unternehmen: „Er fuhr zwei Jahre in der Welt umher und schaute aus seinem Wagen links und rechts an den Häusern hinauf, schaute, wenn er anhielt, nichts als das Schild seines Wirtshauses an, lief dann in der Stadt umher und ließ sich die schönsten Merkwürdigkeiten zeigen. Aber es freute ihn nichts, kein Bild, kein Haus, keine Musik, kein Tanz; sein Herz von Stein nahm an nichts Anteil, und seine Augen, seine Ohren waren abgestumpft für alles Schöne. Nichts war ihm mehr geblieben als die Freude an Essen und Trinken und der Schlaf, und so lebte er, indem er ohne Zweck durch die Welt reiste, zu seiner Unterhaltung speiste und aus Langeweile schlief.“ Richard Sennett zufolge hat diese Weltreise eine Art taktiler Krise zur Folge: „Willst du dich frei bewegen, dann darfst du nicht allzu viel fühlen.“
In dieselbe Zeit fällt das Grimm‘sche Märchen „Die drei Feldscherer“. Auch hier haben wir es mit mobilen Menschen zu tun, mit Menschen, die keine Bindung kennen, finden doch Kriege, in denen Feldscher ihr Können unter Beweis stellen, einmal da, dann dort statt. Auch hier spielt die Geschichte in einem Gasthaus, also an einem Nicht-Ort, an dem die Gesetze des Geldverkehrs gelten, an einem Ort, dessen soziales Leben sich allgemeiner Codes verdankt. An all solchen Orten sind die Zahlungsmodalitäten mehr oder weniger dieselben. Aber da sich, würde alles so funktionieren wie vorgegeben, keine Geschichte, schon gar kein Märchen erzählen ließe, muss einiges durcheinander geraten, bedarf es eines unvorhergesehenen Zufalls.
Die drei Feldscherer sind im Besitz einer Salbe, die jede Wunde zu heilen vermag. Um dem Wirt ihre Kunst zu beweisen, schneidet sich der erste seine Hand ab, der zweite reißt sich sein Herz heraus, der dritte sticht sich seine Augen aus, um sie am folgenden Morgen wieder einzuheilen. Sie überlassen ihre Organe dem Wirt, der sie auf einen Teller legt und das Mädchen heißt, diesen in den Schrank zu stellen und wohl aufheben. Das Mädchen hat „einen heimlichen Schatz“, einen Soldaten, der ebenso bindungslos ist wie die drei Feldscherer. Als alle im Haus schlafen, kommt der Soldat und will etwas zu essen haben. Das Mädchen geht zum Schrank, holt Brot, Wurst und Käse, vergisst aber, den Kasten wieder zu verschließen. Kurz und gut: Eine Katze frisst die auf den Teller gelegten Organe. Der Soldat weiß Abhilfe, als sich das Mädchen dessen bewusst wird. Die Hand beschafft er sich von einem Dieb, den man gehängt hat, die Augen sticht er einer Katze aus, auch für das Herz findet sich Ersatz, liegt doch im Keller ein frisch geschlachtetes Schwein. Am folgenden Morgen heilen sich die drei Feldscherer die ihnen untergeschobenen Organe ein und werden vom Wirt bewundert. Nur schnüffelt der eine schon bald wie ein Schwein in jeder Ecke, der mit der Diebeshand beginnt zu stehlen und der mit den Katzenaugen sieht plötzlich Mäuse, wo die anderen keine sehen.
Nicht zufällig haben wir es auch im Hauff‘schen Märchen mit einem Organtausch zu tun. Peter Munk wird anstelle seines eigenen Herzens eines aus Stein eingesetzt. Zweifellos hatte Hauff anatomische Präparate vor Augen: „Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser, mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt, und in jedem dieser Gläser lag ein Herz; auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben.“ Gleichzeitig klingt das Sortiment eines Warenhauses an. Dabei ist das Motiv dem Buch Ezechiel entlehnt: „Ich werde ihnen ein einziges Herz geben und einen neuen Geist in ihr Inneres legen und werde entfernen das Herz aus Stein aus ihrem Leibe und ihnen ein Herz von Fleisch geben.“
Wir können nicht zurück in das Hauff‘sche Idyll. Es gibt kein Glasmännlein, das uns vor den Versprechen eines Holländer-Michel bewahren könnte. Die Globalisierung lässt sich nicht rückgängig machen. Wohl aber müsste es möglich sein, Produkte komplexer zu denken, damit sie jenen Mehrwert erlangen, der sich als Schönheit bezeichnen ließe, Produkte, die in ihrer Funktionalität umfassender sind, als dies ein Massenprodukt je sein kann.
Ich kaufe Fleisch in einer kleinen Metzgerei, in einer der wenigen noch verbliebenen Metzgereien. Ganz abgesehen davon, dass das hier angebotene Fleisch von Bauern der Umgebung stammt oder dass man bestens auf die Zubereitung eingestimmt wird, kann man, vor einer Vitrine stehend, in der neben vielem anderen noch Schweinsfüße und Kalbszungen liegen, dem Metzger dabei zusehen wie er mit gekonnten Bewegungen das gewünschte Fleisch auswählt und kunstfertig herrichtet. Kaufen wir vakuumiertes Fleisch in einem Supermarkt, dann bietet sich dieses nach dem Öffnen als bluttriefender Klumpen dar. Hier dagegen haben wir es mit gut abgehangenem Fleisch zu tun, das seine ganze Struktur zeigt. Während dort alles stumm ist, wird hier gesprochen, kommentiert, oft auch erzählt. Auch trägt der Metzger keine Plastikhandschuhe, weiß er doch, dass solche wenig mit Hygiene, viel dagegen mit jenem Unbehagen zu tun haben, das mit heutigen Produktionsformen einhergeht. Keinesfalls haben wir es mit einem Konsumakt zu tun, in dem man als Konsument einer ähnlichen Bewirtschaftung unterliegt wie die angebotenen Waren. Man kennt sich, man unterhält sich. So eine Metzgerei ist noch ein sozialer Raum, auf jeden Fall noch eine Schnittstelle zwischen Produzenten und Konsumenten. Da klingt das an, was ich mit Schönheit meine. Gelobt seien gute technische Lösungen, aber ohne Rückbindung in das Soziale, das konkrete Leben der Menschen, kann es keine Schönheit geben. Das gilt für Nahrungsmittel wie Fleisch, für Holzbauten und vieles andere.
RADIO DRAMA
___ Das Wirtshaus zur Hand des Gehenkten, 2008, by Bernhard Kathan
Martin Breindl, VON STAUB, SAUGERN UND ROBOTERN [German only]
LUFT.
„Die Schwingungen der Luft, sind sie erst einmal durch die menschliche Stimme in Gang gesetzt, hören nicht zusammen mit den Lauten, die sie hervorgerufen haben, auf zu existieren. Kräftig und hörbar, wie sie in der unmittelbaren Umgebung des Sprechers und im Augenblick ihrer Äußerung sein mögen, sind sie dank der raschen Abnahme ihrer Energie bald schon für das menschliche Ohr nicht mehr vernehmbar. Die Bewegung, in die sie die Partikel eines Teils unserer Atmosphäre versetzt haben, pflanzt sich ständig in wachsendem Umfange fort (…) Was für ein merkwürdiges Chaos ist, so betrachtet, diese weiträumige Atmosphäre, die wir atmen! Jedes Atom ist durchdrungen von guten und bösen Regungen und enthält zur gleichen Zeit die Bewegungen, die Philosophen und Weise ihm mitgeteilt haben, vermischt und auf zehntausenderlei Weise verbunden mit allem möglichen Wertlosen und Gemeinem. Die Luft selbst ist eine riesige Bibliothek, auf deren Seiten für immer alles verzeichnet steht, was je Männer und Frauen geäußert oder geflüstert haben.“
Was Gewicht hat, fällt zu Boden. Daran sei die Schwerkraft schuld, so sagt man. Es widerspricht in gewissem Sinn unserer Wahrnehmung, denn geschieht dies nicht auch mit dem Leichten, dem Ephemeren? Mit Blättern, Federn, Schneeflocken, Staub? Und was ist mit gewichtigen Worten – wiegen sie schwerer als gedankenlos oder leicht Dahingesagtes? Fallen auch sie, ein Opfer der Schwerkraft, zu Boden, bleiben dort liegen, dem Wind, dem Wetter, der Verwitterung ausgesetzt? Wäre man ein aufmerksamer Spaziergänger, könnte man sie von dort auflesen. Im Flanieren Wortfindung betreiben. Sie sich genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Oder aber hinunterschlucken. Das Gesagte verdauen. Falls es sich nicht als unverdaulich herausstellte.
STAUB.
„Was man so sehr prächtig Sonnenstäubchen nennt, sind doch eigentlich Dreckstäubchen.“
Was immer gesagt oder geschrieben wird, hinterlässt Spuren. Spuren kann man lesen. Das wissen sowohl die indigenen Völker als auch die Forensiker. Aber nur wenige von uns sind geübt darin; die meisten trampeln achtlos über sie hinweg, verwischen sie, machen sie unkenntlich, zerstören sie. Spuren werden unlesbar.
Wie alles andere sind Spuren der Erosion ausgesetzt. Sie zerfallen in immer kleinere Teile, Partikel, granulieren und werden schließlich zu Staub. In der Informationstheorie würde man sagen, sie zerlegen sich in immer kleinere Informationseinheiten. Die kleinste davon, die nicht mehr teilbar ist, nennt man Bit. Dieses ist nichts Visuelles, nichts Klangliches und auch kein Text. Man kann es weder sehen noch hören, fühlen, riechen oder schmecken. Ein Bit ist die kleinste Einheit der Zeichen, ein Elementar- und Universalzeichen.
SOG.
„Umwelten sind keine passiven Hüllen, sondern eher aktive Vorgänge, die unsichtbar bleiben. Die Grundregeln, durchgängige Struktur und die umfassenden Muster entziehen sich einer oberflächlichen Wahrnehmung.“
Seit mindestens dreißig Jahren umspannt ein digitales Netz unsere Welt, das wie ein Myzel in alle Richtungen wuchert und mittlerweile jeden Lebensbereich durchdringt. Eine gigantische Maschinerie, die alles, was wir denken und produzieren, absaugt, über Leiterbahnen blitzschnell an andere Orte verfrachtet, auf Servern speichert, von denen wir nicht wissen, wo sie sich befinden, es computiert, re-kombiniert, re-konfiguriert und in Echtzeit an tausende andere Orte distribuiert. Man könnte sich dieses Netz auch als ein globales kommunizierendes Röhrensystem denken, das Information in endlose Kreisläufe und elektrische Wellenbewegungen schickt, und an deren Tentakeln wir mit unseren Mobiltelefonen, Computerbildschirmen und Infoscreens hängen. Aber nicht nur wir; auch die Schaltzentralen der Weltwirtschaft, der Medien, der Politik und des Militärs. Alle sind Teile eines technischen Systems, von dem wir nicht im Geringsten wissen, wie es funktioniert, geschweige denn, was es produziert. Trotzdem vertrauen wir ihm. Wir sind abhängig von der Aufmerksamkeitsökonomie, die es uns aufzwingt.
BOT.
„Was sagt die Sprache zu sich selbst, wenn keiner zuhört?“
Dieses System wurde von Anbeginn an von Robotern bewohnt, sogenannten Bots. Es sind dies weitgehend unabhängig agierende Programme, die Informationen aufspüren, zusammentragen und Suchmaschinen zur Verfügung stellen. Ohne Ziel und Plan durchstreifen sie das Netz und saugen massenhaft Bits ein, also den Staub der Information. Schon vor vielen Jahren schätzte man, dass neunzig Prozent der Texte, die im Internet veröffentlicht werden, ausschließlich von diesen Robotern gelesen werden. Von Peter Weibel stammt der Ausspruch: „Mein Ziel ist es, die beste Suchmaschine zu werden.“ Es ist anzunehmen, dass er es ernst meinte. Er wollte einfach alles lesen.
In letzter Zeit scheinen die Bots intelligent zu werden, man spricht dann von Künstlicher Intelligenz. Sie treffen mehr und mehr Entscheidungen, lernen, produzieren eigene Texte und neue Information, wachsen und vermehren sich sogar. Darin sind sie uns Menschen gar nicht so unähnlich. Menschliche Intelligenz wird oft mit Effizienz, also Angepasstheit, verwechselt. Die klassischen IQ-Tests sind ein gutes Beispiel dafür. Wir Menschen neigen außerdem zu Bequemlichkeit und überlassen Entscheidungen gerne den anderen. Da die Künstlichen Intelligenzen damit keinerlei Schwierigkeiten haben und zudem viel effizienter zu sein scheinen ist zu befürchten, dass wir ihnen mehr und mehr Entscheidungen überlassen. Und uns zurücklehnen und sie bei ihrem Tun beobachten. Vergessend, dass wir immer noch an den Tentakeln dieser Weltwirtschafts-, Medien-, Politik- und Militärmaschinerie hängen. Wenn wir das jedoch zulassen, wäre es nicht die Künstliche, sondern die Menschliche Intelligenz, die wir in Frage stellen sollten.
LUFT.
„Die Schwingungen der Luft, sind sie erst einmal durch die menschliche Stimme in Gang gesetzt, hören nicht zusammen mit den Lauten, die sie hervorgerufen haben, auf zu existieren. Kräftig und hörbar, wie sie in der unmittelbaren Umgebung des Sprechers und im Augenblick ihrer Äußerung sein mögen, sind sie dank der raschen Abnahme ihrer Energie bald schon für das menschliche Ohr nicht mehr vernehmbar. Die Bewegung, in die sie die Partikel eines Teils unserer Atmosphäre versetzt haben, pflanzt sich ständig in wachsendem Umfange fort (…) Was für ein merkwürdiges Chaos ist, so betrachtet, diese weiträumige Atmosphäre, die wir atmen! Jedes Atom ist durchdrungen von guten und bösen Regungen und enthält zur gleichen Zeit die Bewegungen, die Philosophen und Weise ihm mitgeteilt haben, vermischt und auf zehntausenderlei Weise verbunden mit allem möglichen Wertlosen und Gemeinem. Die Luft selbst ist eine riesige Bibliothek, auf deren Seiten für immer alles verzeichnet steht, was je Männer und Frauen geäußert oder geflüstert haben.“
Charles Babbage, The Ninth Bridgewater Treatise; A Fragment, London 1837
Was Gewicht hat, fällt zu Boden. Daran sei die Schwerkraft schuld, so sagt man. Es widerspricht in gewissem Sinn unserer Wahrnehmung, denn geschieht dies nicht auch mit dem Leichten, dem Ephemeren? Mit Blättern, Federn, Schneeflocken, Staub? Und was ist mit gewichtigen Worten – wiegen sie schwerer als gedankenlos oder leicht Dahingesagtes? Fallen auch sie, ein Opfer der Schwerkraft, zu Boden, bleiben dort liegen, dem Wind, dem Wetter, der Verwitterung ausgesetzt? Wäre man ein aufmerksamer Spaziergänger, könnte man sie von dort auflesen. Im Flanieren Wortfindung betreiben. Sie sich genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Oder aber hinunterschlucken. Das Gesagte verdauen. Falls es sich nicht als unverdaulich herausstellte.
STAUB.
„Was man so sehr prächtig Sonnenstäubchen nennt, sind doch eigentlich Dreckstäubchen.“
Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbuch, 1789-1794
Was immer gesagt oder geschrieben wird, hinterlässt Spuren. Spuren kann man lesen. Das wissen sowohl die indigenen Völker als auch die Forensiker. Aber nur wenige von uns sind geübt darin; die meisten trampeln achtlos über sie hinweg, verwischen sie, machen sie unkenntlich, zerstören sie. Spuren werden unlesbar.
Wie alles andere sind Spuren der Erosion ausgesetzt. Sie zerfallen in immer kleinere Teile, Partikel, granulieren und werden schließlich zu Staub. In der Informationstheorie würde man sagen, sie zerlegen sich in immer kleinere Informationseinheiten. Die kleinste davon, die nicht mehr teilbar ist, nennt man Bit. Dieses ist nichts Visuelles, nichts Klangliches und auch kein Text. Man kann es weder sehen noch hören, fühlen, riechen oder schmecken. Ein Bit ist die kleinste Einheit der Zeichen, ein Elementar- und Universalzeichen.
SOG.
„Umwelten sind keine passiven Hüllen, sondern eher aktive Vorgänge, die unsichtbar bleiben. Die Grundregeln, durchgängige Struktur und die umfassenden Muster entziehen sich einer oberflächlichen Wahrnehmung.“
Marshall McLuhan, Das Medium ist Massage, 1969
Seit mindestens dreißig Jahren umspannt ein digitales Netz unsere Welt, das wie ein Myzel in alle Richtungen wuchert und mittlerweile jeden Lebensbereich durchdringt. Eine gigantische Maschinerie, die alles, was wir denken und produzieren, absaugt, über Leiterbahnen blitzschnell an andere Orte verfrachtet, auf Servern speichert, von denen wir nicht wissen, wo sie sich befinden, es computiert, re-kombiniert, re-konfiguriert und in Echtzeit an tausende andere Orte distribuiert. Man könnte sich dieses Netz auch als ein globales kommunizierendes Röhrensystem denken, das Information in endlose Kreisläufe und elektrische Wellenbewegungen schickt, und an deren Tentakeln wir mit unseren Mobiltelefonen, Computerbildschirmen und Infoscreens hängen. Aber nicht nur wir; auch die Schaltzentralen der Weltwirtschaft, der Medien, der Politik und des Militärs. Alle sind Teile eines technischen Systems, von dem wir nicht im Geringsten wissen, wie es funktioniert, geschweige denn, was es produziert. Trotzdem vertrauen wir ihm. Wir sind abhängig von der Aufmerksamkeitsökonomie, die es uns aufzwingt.
BOT.
„Was sagt die Sprache zu sich selbst, wenn keiner zuhört?“
Allucquére Rosanne Stone, Media Memory, 1996
Dieses System wurde von Anbeginn an von Robotern bewohnt, sogenannten Bots. Es sind dies weitgehend unabhängig agierende Programme, die Informationen aufspüren, zusammentragen und Suchmaschinen zur Verfügung stellen. Ohne Ziel und Plan durchstreifen sie das Netz und saugen massenhaft Bits ein, also den Staub der Information. Schon vor vielen Jahren schätzte man, dass neunzig Prozent der Texte, die im Internet veröffentlicht werden, ausschließlich von diesen Robotern gelesen werden. Von Peter Weibel stammt der Ausspruch: „Mein Ziel ist es, die beste Suchmaschine zu werden.“ Es ist anzunehmen, dass er es ernst meinte. Er wollte einfach alles lesen.
In letzter Zeit scheinen die Bots intelligent zu werden, man spricht dann von Künstlicher Intelligenz. Sie treffen mehr und mehr Entscheidungen, lernen, produzieren eigene Texte und neue Information, wachsen und vermehren sich sogar. Darin sind sie uns Menschen gar nicht so unähnlich. Menschliche Intelligenz wird oft mit Effizienz, also Angepasstheit, verwechselt. Die klassischen IQ-Tests sind ein gutes Beispiel dafür. Wir Menschen neigen außerdem zu Bequemlichkeit und überlassen Entscheidungen gerne den anderen. Da die Künstlichen Intelligenzen damit keinerlei Schwierigkeiten haben und zudem viel effizienter zu sein scheinen ist zu befürchten, dass wir ihnen mehr und mehr Entscheidungen überlassen. Und uns zurücklehnen und sie bei ihrem Tun beobachten. Vergessend, dass wir immer noch an den Tentakeln dieser Weltwirtschafts-, Medien-, Politik- und Militärmaschinerie hängen. Wenn wir das jedoch zulassen, wäre es nicht die Künstliche, sondern die Menschliche Intelligenz, die wir in Frage stellen sollten.